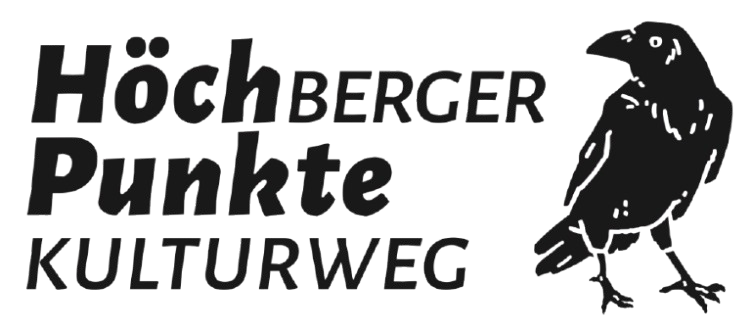Marktplatz
Marktplatz und Gasthaus Lamm
Die Schulgasse hatte bis in die frühen 1980er Jahre noch einen direkten Zugang zur Hauptstraße (heute Bibliothek). Bis zum Abriss 1981 stand hier das Geburtshaus von Martin Wilhelm (Schulgasse 1).
Auf dem 1987 neu geschaffenen Marktplatz wurden zwei Kastanienbäume gepflanzt. Die halbrunde Steinbank wurde im Zuge der Umgestaltung 2016 an die Kreuzung Bergstraße/ Kister Straße versetzt.
Der Marktplatz als Festplatz
Am letzten Juniwochenende 1980 fand das erste Straßenfest in der Hauptstraße statt. Ab 1987 wurde auch der neue Marktplatz mit dazu genutzt. Seit der Markterhebung 1990 heißt das große Fest zu dessen gelingen viele Vereine beitragen „Höchberger Marktfest“.
Am ersten Mai jeden Jahres findet der traditionelle „Tanz um den Maibaum“ des Heimat und Trachtenvereins statt, dessen Mitglieder in typisch fränkischer Tracht tanzen.
Am Kirchweih-Sonntag können sich die Bürger am „Hammeltanz“ und „Göggerlesschlagen“ auf dem Marktplatz beteiligen.
Die Geschichte vom „Höchberger Bannwein“
Bannwein – eine Idee zeigt Wirkung
von Stephanie Nomayo aus dem Höchberger Lesebuch
Die folgenden Textzeilen aus den Stiftspsrotokollen des Ritterstifts St. Burkard brachten die Autorin der Geschichte – Bannwein – Eine Idee zeigt Wirkung – aus dem Höchberger Lesebuch, Frau Stephanie Nomayo, auf die Idee, dass es als Highlight zur Kirchweih des 1250. Festjahres von Höchberg einen Jubiläumswein geben soll, um daran zu erinnern, dass auch in Höchberg einst Weinbau betrieben wurde.
04.Juni 1585: „Sofern sich sich bescheidenlich verhalten würden, sei die Kirchweih zu halten erlaubt und soll ihnen ungefähr ein Fuder Bannwein hinausgelegt und die Maß um sieben alte Pfennig gegeben werden…“
16. Juli 1593: (Der Höchberger Schultheiß wird zur Sitzung des Stiftskapitels geladen, er hat sich für unerlaubte Vorgänge auf der Höchberger Kirchweih zu verantworten, unter anderem, daß sie – die Höchberger – …) „jüngst zur Kirren ein Schießen um einen Hemmel (Hammel) und Kugelspiel abgehalten“…sie werden gefragt, er ihnen dies erlaubt habe, da sie zuvor das Kapitel oder den Amtmann um Erlaubnis hätten bitten müssen…..die Entschuldigung der Höchberger wurde nicht angenommen, sondern dem Amtmann befohlen, den Schultheiß und alle anderen in die Kolkammer zu legen. Dazu sollen 4 Gulden für den Bannwein, der sonst hätte hinausgelegt hätte erden können, eingefordert werden…
Die Autorin erklärt dazu:
Soviel sollt man wissen, die oben zitierten Einträge aus den Stiftsprotokollen von St. Burkard versetzen uns ins ausgehende Mittelalter, eine Zeit, in der das Würzburger Ritterstift als Grundherr das Leben der leibeigenen Höchberger Dorfbewohner mit einer eigenen Dorfordnung und Bestimmungen wie Zehntverordnung, gilt. In der sowohl Besthaupt als auch Handlohn von der Wiege bis zum Sarg geregelt wurden. Das Leben bestand aus Arbeit. So war die Kirchweih, die auf Gnade und Geheiß des Stiftskapitels einmal im Jahr gefeiert werden könnte, eine willkommene Unterbrechung. Allerdings musste der Höchberger Schultheiß jedes Jahr mit einem Häuflein Getreuer um die Erlaubnis zur Ausrichtung der Kirchweih bei den hohen Herren nachsuchen. Diese wiederum – wenn sie gut aufgelegt waren – ließen alles durchgehen, fast alles. Verboten waren: Tanz, Krämerei und Spiel. Zu meiden waren Zank und Hader. Um dem übermütigen Geschehen an der Kirchweih gewisse Schranke aufzuerlegen, gab es vielerorts die „Kirchweih – oder Planwächter“. Diese gingen im Harnisch und übten den Kirchweihschutz aus. Sie hatten die Pflicht für den Kirchweihfrieden zu sorgen. Wer den Frieden nicht einhielt, hatte mit einer hohen Geldstrafe oder mit der Kolkammer (Arrestlokal in Würzburg) zu rechnen. Viele Menschen kamen auch aus der Umgebung, um mit den Höchbergern zu feiern. Endlich gab es ordentlich zu Essen und zu Trinken – mit einer Einschränkung, die Höchberger durften an der Kirchweih keinen Wein ausschenken! Das Stift St. Burkard verbot an diesem Tag den allgemeinen Weinausschank und lieferte seinen eigenen Wein, den sogenannten Bannwein.
Mit Bannwein war das Recht gemeint, daß der Dorfherr, das bedeutete die hohen Herren des Stiftskapitels, durch die Höchberger Schankwirte den von ihnen gelieferten Wein in vorgegebener Menge zu vorgegebenem Preis verkaufen konnten, bevor die Höchberger ihren eigenen Wein anbieten durften. So mussten die Höchberger Dorfbewohner beispielsweise am 18. Juni 1537 11 1/2 Eimer Bannwein, das heißt fast ein Fuder Wein (das ist eine Wagenladung bestehend aus 12 Eimern) zu 4 Pfennig die Maß abnehmen. (Ein Eimer waren 60 Maß a 1,33 l). Qualitativ handelte es sich bei dem Bannwein oftmals um minderwertigen, zum Teil auch mit Wasser verdünnten Wein aus den stiftseigenen Weinlagen. Die Lagen des Ritterstifts befanden sich unter anderem in der heute noch die vorzüglichsten Frankenweine liefernden „Leiste“. So besaß das Ritterstift St. Burkhard um das Jahr 21600 zehn Morgen (= 1962,17 qm) Weinanbaufläche und war damit nach dem Kellereiamt des Neumünsters und dem Fürstbischof der drittgrößte Anteilseigner in der „Leiste“.
Der Jubiläumswein wurde als „Höchberger Bannwein“ aus der Leiste (Innere Leiste Riesling Kabinett aus dem Staatl. Hofkeller Würzburg) angeboten und die „erste Höchberger Bannweinfahrt“ am 12.10.1997 zur Höchberger Kirchweih inszeniert.
Der Bannwein sollte zum offziellen Ratsherren-Umtrunk am Marktplatz nach Höchberg gefahren werden. Dazu trugen nicht nur die Ratsherren (Gemeinderat) bei, sondern auch das aus ca. 50 Mitgliedern des Höchberger Verschönerungsvereins und des Obst-und Gartenbauvereins bestehende Bauernvolk, alle in speziell dafür geschneiderten Kostümen. Mit einem Pferdefuhrwerk machte sich der ganze Tross auf zur Würzburger Residenz, um im staalt. Hofkeller ein Faß des Jubiläumsweines abzuholen. Das Fuhrwerk wurde nicht nur von den Ratsherren und vom Bauernvolk, sondern auch von den Fanfaren in ihren farbenfrohen Uniformen begleitet. Der Kellermeister empfing die Gäste und stellte den Jubiläumswein, der in einem blauen Bocksbeutel mit Höchberger Ansicht in Goldauflage auf der Rückseite abgefüllt war, vor. Danach wurde der Wein verkostet, das Fass auf das Fuhrwerk aufgeladen und der Zug, mit den Fanfaren an der Spitze, setzte sich in Bewegung. Der Weg führte durch die Neubau- und Augustinerstraße und über die Alte Mainbrücke zur Stiftskirche von St. Burkard.
Hier wurden die Herren des Stiftskapitels, ganz so wie es in den Stiftsprotokollen überliefert ist, um die Erlaubnis zur Ausrichtung der Kirchweih und um die gar freundliche Hinauslegung des damals unbeliebten Bannweins gebeten.
Das Stiftskapitel, in Gestalt des damaligen Pfarrers von St. Burkard, gestattete erst nach guter Zurede des Schultheißen (1. Bürgermeiste Peter Stichler) die Ausrichtung der „Kirben“, aber nur unter der Auflage „züchtig“ zu sein und alle „Däntz“ und „Kräm“ zu verbieten.
Das Bauernvolk unterbrach die hohen Herren immer wieder mit dem Zwischenruf „in fette Herrn und sauren Wien da fahr doch gleich der Teufel rein“.
Dann machte der ganze Zug sich auf den Weg durch den Leistengrund nach Höchberg zum Marktplatz. Dort berichtete der Schultheiß dem wartenden Volk vom erfolgreichen Bittgesuch und eröffnete die Kirchweih 1997.
Die oben beschriebenen „unerlaubten Vorgänge“ bei der Kirchweih 1593 „…zur Kirren ein Schießen um einen Hemmel (Hammel) und Kugelspiel abgehalten“…werden immer noch, in etwas veränderter Form, fortgeführt. Sie heißen heute Hammeltanz und Göggerlesschlagen und finden seit den 1970er Jahren am Kirchweihsonntag auf dem Marktplatz statt.